Rechte Symbolik und Hetze auf Social Media: welche Praktiken genutzt werden und was man dagegen tun kann
Rechtsextreme Inhalte haben durch das Internet eine neue Bühne gefunden. Plattformen wie TikTok, Facebook und Telegram bieten die Möglichkeit, über versteckte Symbole, manipulative Memes und virale Trends eine breite Zielgruppe zu erreichen – oft ohne dass es auf den ersten Blick offensichtlich ist. In diesem Artikel fassen wir euch zusammen, welche Praktiken dabei verwendet werden und welche Maßnahmen wir ergreifen können, um rechten Inhalten auch digital auf Social Media entschieden entgegenzutreten.
Woher kommt die Reichweite?
Rechte Gruppen haben erkannt, dass TikTok eine besonders effektive Plattform ist, um junge Zielgruppen mit vermeintlich unpolitischen Inhalten zu erreichen. Sie nutzen „harmlos“ wirkende Trends, wie den Tradwife-Trend, um auf subtile Weise rechtsextreme Botschaften zu verbreiten.
Auch die Verwendung von KI polarisiert, um Fake-Inhalte zu erstellen, schnell auf virale Trends aufzuspringen und Reichweite zu gewinnen. Diese Taktik ermöglicht es, rechtes Gedankengut unauffällig zwischen Tanzvideos und Memes zu platzieren. Besonders Menschen mit geringer Medienkompetenz – darunter sehr junge und ältere Nutzer*innen – fallen dann auf solche Inhalte herein.
Bei Wähler*innen rechter Parteien zeigt sich auch, dass Follower eher einzelnen, aufmerksamkeitserregenden Personen auf der Plattform folgen als den Parteiseiten selbst. Diese erzielen durch ihre TikToks und Reels jedoch eine enorme Reichweite – während andere Politiker*innen diese Kanäle bisher kaum nutzen.
Neben negativ besetzten Themen, die Hass schüren sollen konzentrieren sich rechte Social-Media-Inhalte oft auch auf vermeintlich positiv besetzte Themen wie „Stolz“ und „Tradition“, um junge Menschen in ihrer Findungsphase gezielt zu beeinflussen. Dabei wird ein kämpferischer Ton angeschlagen, der junge Nutzer*innen emotional anspricht und subtil rechtsextreme Ideologien normalisiert.
Verschlüsselte Symbole und Codes
Ein zentraler Aspekt der Verbreitung rechter Ideologie im Netz sind verschlüsselte Symbole, die für Gleichgesinnte leicht zu erkennen sind. Dazu zählen u. a. Zahlencodes wie 88 oder 18 (basierend auf den Positionen der Buchstaben im Alphabet), welche in rechtsextremen Kreisen als Chiffren für bestimmte Parolen oder ideologische Bezüge verwendet werden. Auch Emojis, die Außenstehenden ungefährlich erscheinen, können eine verschlüsselte Bedeutung tragen.

Auch populäre Memes wie „Pepe the Frog“, die ursprünglich harmlose Internetphänomene waren, wurden bereits von der rechten Szene gekapert, um rechte Botschaften zu verbreiten. Diese humoristische Form verschleiert den Ernst der Botschaften und erreicht dadurch eine jüngere Zielgruppe.
Zusätzlich verwenden Rechtsextreme germanische Runen als Symbole, die bewusst auf früheren rechtsextremen Bewegungen hindeuten. Diese Symbole sind für Außenstehende oft schwer zu deuten, wodurch die Radikalisierung unauffällig voranschreiten kann. Auch Hashtags teilweise dazu, eine Gemeinschaft zu bilden und menschenfeindliche Inhalte zu verbreiten.
Weitere Taktiken auf Social Media
- Ironie und Subversion: Rechte nutzen Ironie, um ihre Botschaften zu tarnen. Das erlaubt ihnen, bei Kritik zu behaupten, alles sei nur ein „Scherz“ gewesen. Gleichzeitig normalisiert es ihre Ansichten, da sie in einem vermeintlich harmlosen Kontext auftreten.
- Plattformhopping: Sobald rechte Inhalte auf einer Plattform erkannt und gelöscht werden, ziehen die Gruppen auf andere Plattformen um. Diese Taktik ist besonders bei jüngeren Rechten zu beobachten, die von Plattformen wie Facebook zu alternativen Netzwerken wie Telegram wechseln. Plattformen wie Telegram und Co. sind dabei als besonders gefährlich einzustufen, da die Nachprüfbarkeit durch Verschlüsselung sehr schwierig gestaltet ist. Man spricht hierbei auch von „Dark Social“.
- Gamification: Rechte Aktivist*innen nutzen Prinzipien aus der Welt der Videospiele, um ihre Anhänger zu motivieren. Beispielsweise gibt es auf Plattformen „Belohnungen“ für die Verbreitung von Hasskommentaren oder das Posten von rechtsextremen Memes. Dadurch entsteht eine Kultur des Wettbewerbs, die viele junge Nutzer*innen anspricht. Aber auch Gamingplattformen an sich werden genutzt, um Gleichgesinnte zu rekrutieren.
- Zielgerichtete Desinformation: Rechte Gruppen streuen gezielt Desinformation, um Vertrauen in Institutionen und Medien zu untergraben. Fake News und Verschwörungstheorien sind dabei zentrale Themen. Falsche Informationen werden einfach beiläufig eingebracht und dann ungeprüft vervielfältigt.
Was können wir gegen rechte Social-Media-Inhalte tun?
Wie können wir uns am besten im Internet zur Wehr setzen, sowohl mit privaten als auch mit beruflichen Accounts? Es ist wichtig, dass wir als Gesellschaft zusammenrücken, um rechtsextreme Inhalte richtig zu bekämpfen. Hier ein paar Ansätze dazu:
- Bildung und Aufklärung: Regelmäßiges Informieren hilft dabei, neue Trends und Symbole frühzeitig zu erkennen und zu melden. Je mehr Menschen über die verschlüsselten Symbole und Botschaften wissen, desto besser können diese bekämpft werden.
- Digitale Zivilcourage: Es ist wichtig, rechte Kommentare und Hetze nicht zu ignorieren. Nutzer sollten aktiv gegen Hasskommentare vorgehen, diese melden und das Internet nicht den Extremist*innen überlassen.
- Stärkung der Medienkompetenz: Besonders junge Menschen müssen über die Gefahren rechtsextremer Inhalte aufgeklärt werden. Eltern und Pädagogen sollten sich aktiv mit Plattformen wie TikTok und dem Medienkonsum der Jugendlichen auseinandersetzen und diese über Desinformation und Hetze informieren.
- Gesetzliche Regulierung: Leider sind Gesetze gegen Hassrede im Netz noch lückenhaft. Hier sind politische Initiativen und Petitionen entscheidend, um eine strengere Gesetzeslage zu schaffen und Plattformen in die Verantwortung zu nehmen. Dabei kann man Organisationen wie HateAid unterstützen und in härteren Fällen Screenshots sammeln und beim Online-Revier einreichen.
- Rückeroberung der Plattformen: Ein positives Beispiel ist die Aktion des queeren „Stolzmonats“ von Fabian Grischkat, der rechte Hashtags und Wording „zurückerobert“ hat, um diesen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Solche Aktionen zeigen, dass es möglich ist, die Diskurse im Netz positiv zu beeinflussen.
Account-Empfehlungen gegen Rechts
Die Verbreitung rechtsextremer Inhalte im Netz bleibt eine große Herausforderung. Durch die Kombination aus subtiler Symbolik, Plattformwechseln und Desinformation gelingt es rechten Gruppen, ihre Ideologie weitreichend zu verbreiten. Es liegt an uns allen, durch Aufklärung, digitale Zivilcourage und die Forderung gesetzlicher Maßnahmen entgegenzuwirken und das Netz nicht den Hetzer*innen zu überlassen. Nur so schaffen wir ein Internet, das für alle sicher und offen ist. Diese Accounts gehen mit gutem Beispiel voran und setzen sich aktiv für Aufklärung ein:
- keine.erinnerungskultur: Aufklärung zum Thema Holocaust und rechter Symbolik/Wording
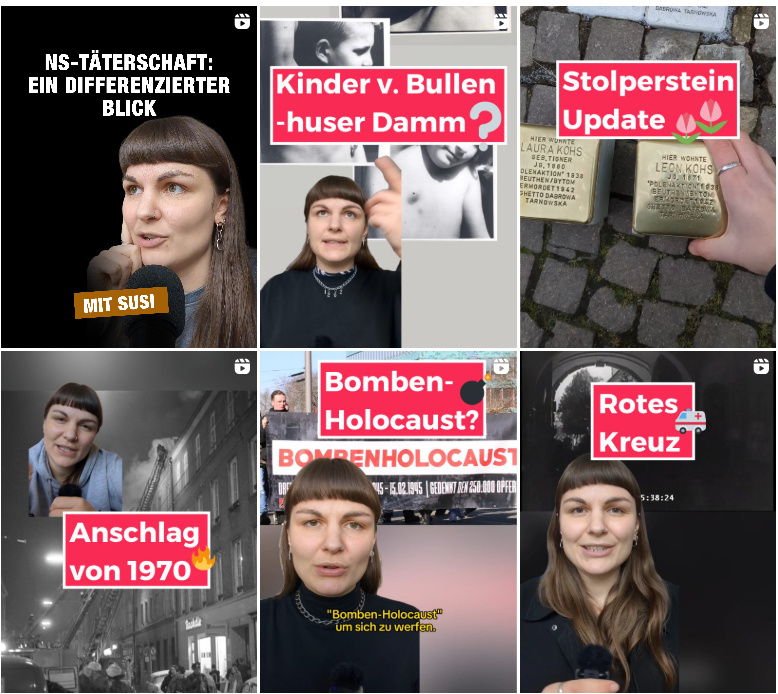
- amadeuantoniofoundation: Aufklärung und Projekte gegen Rechtextremismus, Rassismus, Antisemitismus
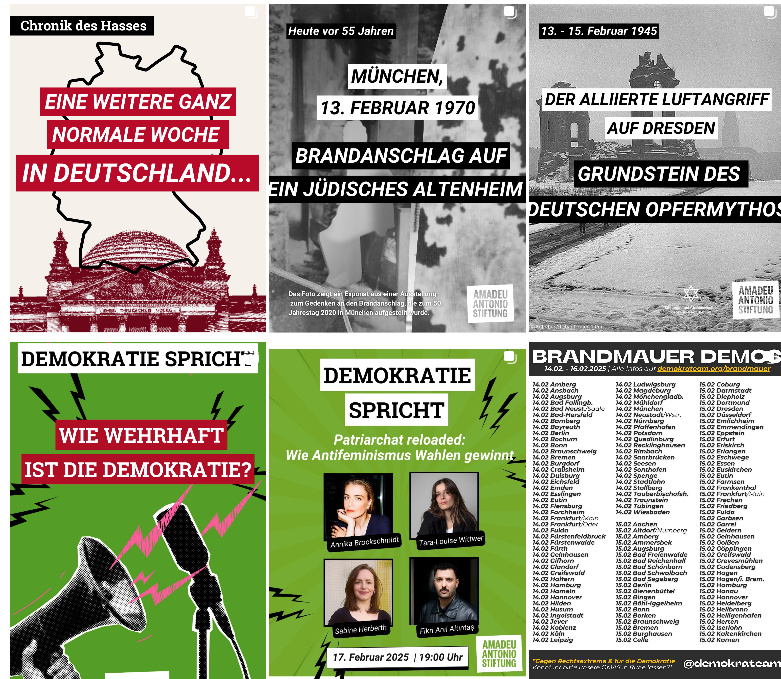
- fabiangrischkat: Aufklärung gegen Rechts, fürs Klima & besonders aus dem Bereich LGBTQIA+, Initiator des queeren #stolzmonats
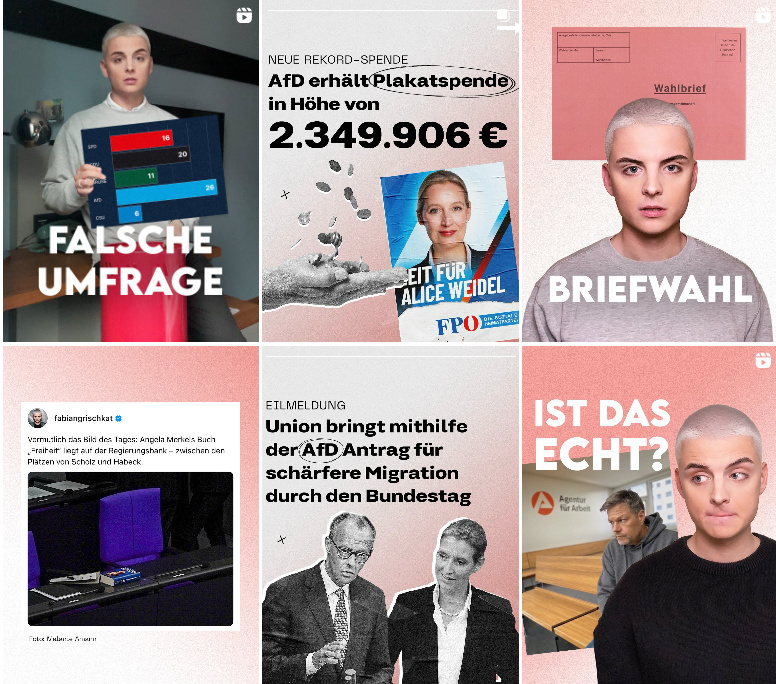
- campact.de: Aufklärung gegen rechte Parteien und Demokratiefeinde
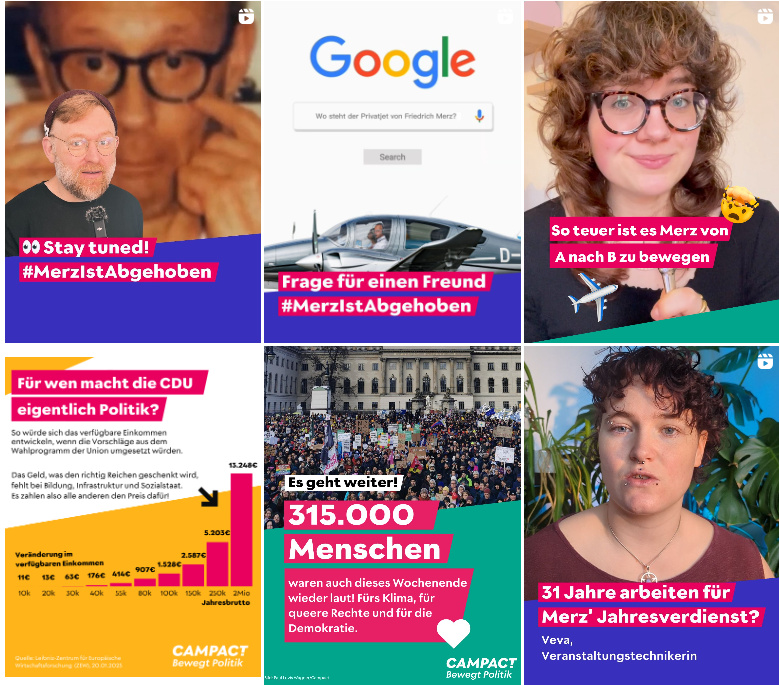
Kurz vor der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 sind die sozialen Medien besonders voll mit politisch Inhalten und Wahlwerbung. Doch auch hier können Desinformation und manipulative Techniken zum Einsatz kommen. Umso wichtiger ist es, sich auf vertrauenswürdige Quellen zu stützen. Eine Auswahl hilfreicher Online-Angebote zur Bundestagswahl findest du hier:
- Wahl-O-Mat: Positioniere dich zu 38 Thesen und erhalte im Anschluss einen Überblick, welche Parteien mit deinen Ansichten am ehesten übereinstimmen.
- Real-O-Mat: Ähnlich zum Wahl-O-Mat positionierst du dich zu verschiedenen Thesen. Der Unterschied? Die Auswertung basiert auf dem realen Abstimmungsverhalten der Parteien im Bundestag.
- zweitstimme.org: Hier findest du wissenschaftlich fundierte Prognosen zur Bundestagswahl. Besonders interessant: Du kannst für alle Wahlkreise und Parteien die vorhergesagten Erststimmenanteile und Gewinnwahrscheinlichkeiten einsehen.
- kandidierendencheck.de: Wahlhilfe für die Erststimme: Hier positionierst dich dich zu 18 Thesen und kannst danach einsehen, mit welchen Kandidierenden in deinem Wahlkreis deine Ansichten am ehesten übereinstimmen.
- wahl.chat: Stelle dem KI-Chatbot Fragen zu verschiedenen politischen Themen und er liefert dir Antworten basierend auf den Wahlprogrammen der Parteien. Ähnlich funktioniert auch WAHLWEISE
- Wahlswiper: Du beantwortest 38 Fragen spielerisch mit einem Wisch nach links für „Nein“ und rechts für „Ja“. Der WahlSwiper errechnet dann die Übereinstimmung mit den Antworten der Parteien.




